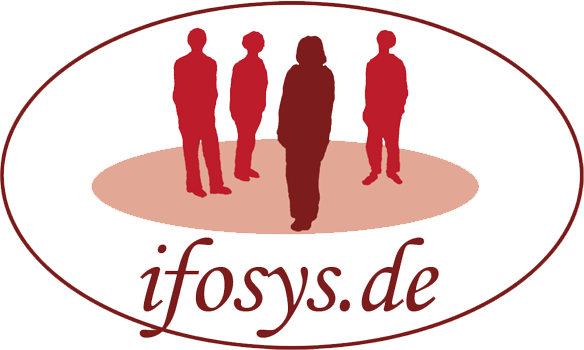Erlebnisbericht von Esther Parmodini Oppermann
Erschienen in CONNECTION 11/97
Den Artikel als PDF downloaden →

Das Telefon schreckt mich hoch: „Wo bleibst Du denn, die Taxe wartet!“ Im gleichen Moment schellt mein Wecker. Ich schaue drauf: Er klingelt definitiv eine Stunde später als tatsächlich eingestellt und lässt sich nur durch wütendes Herausrupfen der Batterie abstellen. Eine Absonderlichkeit, die nie wieder passierte. Meine Angst vor der Höhle scheint so groß zu sein, dass sie sogar elektrische Geräte zum Ausflippen bringt.
Aufbruch in völliger Hektik, ohne Frühstück und Duschen zum Flughafen. Im Flieger schaue ich noch mal in die Vorbereitungsbroschüre, die mir die letzten Wochen ein fast ständiger Begleiter war: „Stirb bevor Du stirbst“ lautet die Überschrift.
Ich bin auf Friedhöfen spazieren gegangen, habe ein paar Tage gefastet, einige von den vorgeschlagenen Übungen und Meditationen gemacht und mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich mir vor dem Gang in die Höhle wirklich meine Haare abrasieren will. Diese Überlegung endete meist in dem Schluss „lieber nicht“, da mir direkt nach der Gruppe einige Vorstellungsgespräche für einen neuen Job bevorstehen. Wie sieht denn das aus, wenn eine Frau mit einer Glatze zum Vorstellungsgespräch erscheint?!
Ich bin fasziniert von der bizarren Kargheit dieser Landschaft. Die ideale Umgebung, um sich mit dem Thema Tod auseinander zusetzen.
Als sich die Gruppe das erste Mal in dem wunderschönen Seminarzentrum trifft, bin ich überrascht, dass nur Frauen dabei sind. Ob die Männer zu feige sind? Ein Mann, der hier eigentlich nur Urlaub machen wollte, entschließt sich dann spontan mitzumachen. Jetzt sind wir sieben.
Ramoda Austermann, Körpertherapeut, Psychologe und Heilpraktiker, leitet die Gruppe. Er hat den „blauen Tod“ unter Betreuung seines Sufi-Lehrers Jabrane Sebnat erlebt.
In der ersten Woche machen wir Übungen zur Vorbereitung auf die drei Tage des Alleinseins. Tibetanische Kum-Nye-Bewegungsmeditationen, die man auch gut im Dunkeln praktizieren kann, Mantras, die uns helfen, mit aufkommenden Ängsten umzugehen, und natürlich stille Meditationen.
Ramoda führt uns sanft und intensiv immer tiefer in das Thema Tod hinein. Der Tod, das einzig Sichere im Leben, der jeden Moment kommen kann. Die Frage „Was würde ich ändern, wenn ich wüsste, dass ich nur ein Jahr zu leben hätte?“ fördert erstaunliche Antworten zu Tage. Ich schreibe meine eigene Grabrede, die mir später, während ich unter einem weißen Laken „beerdigt“ werde, vorgelesen wird.
Wir gehen mit verbundenen Augen am Meer spazieren und machen „Aufräum- und Reinigungsarbeiten“. Wir durchforsten unseren Familien- und Freundeskreis nach ungeklärten Beziehungen und schreiben Briefe, in denen endlich mal auf den Tisch kommt, was schon lange gesagt werden musste.
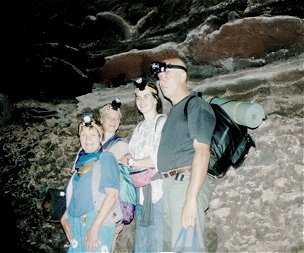
Da in der Höhle jeder für sich sein wird, sind die ersten fünf Tage vorwiegend von Einzelarbeit geprägt. Trotzdem fühle ich mich den anderen Teilnehmern so verbunden wie selten in einer Gruppe zuvor. Jeder hier hat sich diesen Schritt genau überlegt. Jeder steht an irgendeinem entscheidenden Punkt in seinem Leben.
Fast alles, was wir tun, geschieht ruhig und langsam. Nichts zum Auspowern. Das baut Spannung auf. Ich fühle mich wie auf kleiner Flamme gargekocht und habe öfter das Gefühl, dass ich gleich platze, wenn ich nicht sofort eine „Dynamische Meditation“ mache. Gleichzeitig merke ich, dass diese sanfte Arbeit mich sehr nahe an meine Kernprobleme bringt.
Das Thema Angst in all seinen Facetten taucht immer wieder auf. Mir wird eindringlich bewusst, dass all meine Ängste Zukunftsängste sind. Was wird, wenn ich mich drei Tage lang langweile? Was ist, wenn ich Angst vor meinen eigenen Gespenstern bekomme? Angst vorm Alleinsein kriege? Wenn ich mich hilflos fühle? Wenn ich im Dunkeln hinfalle und mir womöglich die Knochen breche? Wenn ich nicht weiß, wohin mit meinem Bewegungsdrang? Wenn ich’s vielleicht gar nicht aushalte und vorzeitig rausgehe….
Endlich kommt der Tag des Aufbruchs. Alle frühstücken noch einmal besonders genussvoll und wir packen unsere Rucksäcke: Schlafsack und Isomatte, Stirn- und Taschenlampe, zwei Kerzen und Streichhölzer, 5 Liter Wasser, etwas Trockenobst und Müsli, Klo- und Zeitungspapier und eine leere Flasche, damit wir Kot und Urin wieder aus der Höhle mit uns hinaus nehmen können, weil dort unten nichts verwest. Und jeder möchte auch einen Talisman oder ein Kuscheltier mitnehmen.
Dann ziehen wir Tarotkarten. Ich frage, was es für mich in der Höhle zu lassen gibt und ziehe „Kompromisse“ – Okay, keine Kompromisse mehr! Die Haare kommen ab. Wenn schon, denn schon! Ich will mich ganz vor Mutter Natur entblößen, will meine Vergangenheit symbolisch abschneiden, will wie ein Neugeborenes in die Höhle gehen. – Oder kahl wie ein Totenschädel?
Die Nacht verbringen wir vor der Höhle im Freien. Vor dem riesigen Loch sitzen wir noch lange beisammen und lauschen den Geräuschen der Nacht. Ich kann mich gar nicht satt sehen an den Sternen.
Am nächsten Morgen machen wir uns an den Abstieg. Mein Gott, da soll ich hinunter? Dieser sonnenbeschienene Krater von 100 Metern Durchmesser und 30 Metern Tiefe kommt mir einen Moment vor wie der Vorhof zur Hölle. Und als ob das nicht genug währe, liegen auch noch weiße, ausgebleichte Tierknochen im Gestrüpp.

Nach einer halben Stunde haben wir den Eingang erreicht. Die Rasierklingen und Scheren werden ausgepackt. Außer mir wagt nur eine weitere Teilnehmerin diesen radikalen Schritt. Jeder darf uns eine Strähne abschneiden. Die erste Strähne wird mit Stoff umwickelt, die wir dann wie ein Schutzamulett als Halsband tragen. Dieses Schrapp-Schrapp der Klingen auf meiner Kopfhaut werde ich wohl nie vergessen. Eine Frau weigert sich beim Schneiden mitzuhelfen. Sie kann es kaum ertragen hinzusehen. Eine andere findet, dass wir mit jedem Schnitt immer schöner werden. Es dauert fast zwei Stunden bis unsere beiden Köpfe endlich spiegelblank sind. Meine Haarpracht wird sorgfältig eingesammelt und in einen Beutel gepackt. Als ich dann in einen kleinen Handspiegel schaue, guckt mich ein völlig neuer Mensch an: soviel Gesicht, meine Mimik überdeutlich, nichts mehr zum Verstecken da und – ich gefalle mir tatsächlich.
Nun gibt es nichts mehr, womit wir den Gang ins Dunkel noch hinauszögern könnten. Wir halten uns ein letztes Mal an den Händen und gehen dann schweigend in den langsam dunkler werdenden Bauch von Mutter Erde.
Die Geräusche von Wind, Meer und Vögeln bleiben hinter uns. Das Gehen wird immer mehr zum Klettern, große Felsbrocken überall. Wir laufen lange bis wirklich kein Schimmer des Tageslichts mehr zu sehen ist.
Irgendwann kommt eine ebene Stelle, und ein erster Teilnehmer fühlt den Impuls, dort zu bleiben. Je weiter wir gehen, desto kleiner wird die Gruppe. Ich nehme den vorletzten Platz im „Stein-Bauch“. Ja, ganz klar, hier ist der Ort für mich.
Im Schein der Kerze richte ich mein Lager ein. Ich rücke Steine zurecht, probiere lange herum, wie ich mich einigermaßen bequem hinlegen kann, stelle mir alle Utensilien in Reichweite, und als ich nichts mehr finde, was ich noch tun könnte, mache ich die Kerze aus. Finsternis. Ich sehe absolut nichts, fasse mir über die Augen, weil ich nicht weiß, ob ich sie offen oder geschlossen habe. Und dann die Stille. Totale Stille. Ich höre nur meinen eigenen Atem. Und nun? Was soll ich jetzt tun? Am besten, ich versuche erst mal zu schlafen. Die mehrstündige Kraxelei war anstrengend. Und tatsächlich schlafe ich bald ein.
Ängstlich und irritiert wache ich wieder auf. Hoffentlich habe ich lange geschlafen, damit schon viel Zeit vergangen ist. Vorsichtig stehe ich auf, zünde die Kerze an, trinke ein wenig Wasser, lösche die Kerze schnell wieder aus. Sie muss ja noch lange halten. Ich versuche, einige der Übungen zu machen, die wir gelernt haben, kann mich aber nicht konzentrieren. Tausend Gedanken im Kopf. Ob mich noch irgendein Mann schön findet, so mit Glatze? Ich ertaste meine nähere Umgebung, lege mich wieder hin, döse, träume wildes Zeug, stehe wieder auf, esse ein paar Feigen und beobachte mein Gedankenkarussell. Wie viel Zeit wohl schon vergangen sein mag?
Ich richte mir einen Sitzplatz an einer Wand ein, kuschel mit den Steinen und lausche in die Stille, schaue in die Dunkelheit und sehe – ein Licht, eine helle Gestalt, eine „Lichtfrau“. Die Erscheinung kommt mir ganz normal und selbstverständlich vor. Die Frau gibt mir deutlich zu verstehen, dass ich jetzt nichts Spezielles zu tun brauche, dass es völlig okay ist, wenn ich mich einfach drei Tage lang ausruhe. Eine Riesenlast fällt von mir ab. Mir wird bewusst, wie viel Stress ich mir gemacht habe, dass ich hier unten etwas ganz Besonderes erleben müsste.
Ich liege Ewigkeiten lang auf den Steinen, während mein Leben an mir vorbeizieht.
Irgendwann höre ich das Klackern von Steinen. Ich bekomme Besuch! Ramoda macht einen Kontrollgang. Mein Herz hüpft vor Freude. Er setzt sich für einen Moment neben mich, fragt, ob alles okay ist und sagt mir, das jetzt der erste Abend sei.
Was? Erst? Wenn er mir gesagt hätte, dass ich schon zwei Tage hier sitze, hätte ich’s auch geglaubt. Wie schnell ich das Zeitgefühl verloren habe! Als ich wieder allein bin, kommen mir meine Freunde in den Sinn. Ich spüre, wie wichtig sie mir sind, wie oft ich achtlos mit Begegnungen umgehe, wie wertvoll ein Moment des stillen Beisammensein ist.

Mein Geruchssinn verfeinert sich zunehmend. Ich rieche, wenn eine Höhlengenossin Hunderte von Metern entfernt ihre Kerze ausbläst, nehme Angstschweiß wahr, manchmal eine salzige Meeresbrise mit Fischgeruch. Ich streichele mir oft über den Kopf, es sind schon kleine Stoppeln zu spüren. Die Pinkelflasche wird voller, meine Kerze kleiner. Alles Zeichen, an denen ich merke, dass die Zeit vergeht.
Nach und nach wird es stiller in mir. Und das Gedankenkarussell dreht sich immer langsamer. Manchmal ist mein Atemrhythmus so langsam, dass ich mich wundere, wie das noch ausreicht, meinen Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Essen wird völlig unwichtig. Ab und zu eine Aprikose, und schon bin ich satt. Hier unten werde ich irgendwie anders ernährt.
Einmal, als die Kerze brennt, sehe ich zwischen den Steinen etwas funkeln. Ich greife danach und habe einen kleinen Kristall in der Hand. Ein Geschenk von Mutter Erde an mich. Ein warmes Glücksgefühl durchflutet mich.
Irgendwann habe ich das deutliche Gefühl, dass mir jemand sanft über die Stirn streicht. Ich fühle mich geborgen, aufgehoben, geliebt, habe ein klares Gefühl der Sicherheit: Hier kann mir nichts Schlimmes passieren. Ich spüre, dass es eine Ebene gibt, wo immer für mich gesorgt ist, wo ich bedingungslos geliebt werde. Etwas ganz Zartes, das zu jeder Sekunde als Basis meines Lebens mitschwingt, das ich nur meistens mit Alltagshektik zudecke. Ich weine. Es ist so unbeschreiblich schön, einfach da zu sein. Keine Gedanken mehr. Ich bin – und das ist völlig ausreichend. Dies zu erleben, ist das größte Geschenk, das ich aus der Höhle mitnehme.
Irgendwann bekomme ich dann die Nachricht, dass wir in einer Stunde rausgehen! Was? Schon? Ich packe freudig meine Sachen und bin noch gar nicht ganz fertig, als Ramoda schon wieder mit einer Teilnehmerin zusammen zurückkommt. Ich habe eine Stunde gebraucht, um die paar Sachen einzupacken? Offenbar bewege ich mich sehr langsam. Der Rückweg, auf dem die Gruppe wieder größer wird, dauert lange. Wir sind alle etwas wackelig auf den Beinen. Viele innige Umarmungen. Es ist wunderbar, andere Menschen zu spüren. Und da – der erste Lichtschimmer. Immer näher am Ausgang werden die Steine farbig, grünes Moos, und dann ein Flecken blauer Himmel – unglaublich – wie Samt. Und dann die Sonne! So strahlend, dass es kaum auszuhalten ist. Wir rasten direkt am Ausgang, damit sich unsere Augen an das Licht gewöhnen können. Ein paar Vögel ziehen vorbei und lachen – wirklich: sie zwitschern nicht, sie lachen und freuen sich mit uns.
Ramoda, der die ganze Zeit am Höhleneingang Wache gehalten hatte, kocht uns auf seinem Campingkocher einen Kaffee. Es ist der köstlichste Kaffee meines Lebens, der mit meinen Freudentränen gewürzt wird.
Ein Hallo von oben. Dort steht schon Marie, eine Helferin des Seminarzentrums, um uns abzuholen. Sie hat Kekse dabei. Lecker. Unsere Glatzen werden bewundert.
Auf der Fahrt zurück zum Zentrum fahren wir durch eine neue Landschaft. Mir ist vorher nie aufgefallen, wie viele verschiedene Farben es hier gibt, wie wunderschön die Hügel geformt sind, wie würzig die Luft riecht.
Dann der Kulturschock: Autos, Menschen, die die Köpfe nach uns umdrehen, laute Musik. Ich merke erst jetzt, wie extrem sensibel ich geworden bin, fühle mich zart und zerbrechlich wie ein Neugeborenes. Aber die Gruppe gibt mir Schutz. Wir bleiben heute ständig zusammen, umarmen uns immer wieder und passen aufeinander auf.
Am Nachmittag treffen wir uns, um miteinander zu teilen, was wir erlebt haben. Eine Frau weint beim Erzählen – das erste mal seit 40 (!) Jahren. Eine andere, vorher sehr ernsthafte, wird zum Kind, das in der Badewanne planscht und mit Quietsche-Entchen spielt. Und ich, die „Power-Frau“, entdecke mit Verwunderung die Kraft, die in der Sanftheit liegt. Sieben Menschen, die drei Tage lang das Gleiche gemacht haben: in Stille und Dunkelheit in einer Höhle gesessen. Sieben völlig unterschiedliche Geschichten. Noch nie ist mir so deutlich geworden, dass sich jeder seine eigene Welt erschafft.
Am Tag nach der Höhle gehe ich mit meinen abgeschnittenen Haaren an die Steinküste und übergebe sie dem Meer. Während ich beobachte, wie sie langsam von den Wellen weggespült werden, ist mir bewusst, dass damit ein Teil meiner Vergangenheit, ein Teil meiner Maske und meiner Ängste fortgeschwemmt wird.
In den vier folgenden Tagen bereitet uns Ramoda wieder auf den Alltag vor. Wir machen integrierende Körperübungen, und für jeden ist klar, dass sich im neuen Leben einiges ändern wird.
Wir kuscheln und lachen viel. Von den Mitarbeitern des Seminarzentrum hören wir, dass unsere „Todesgruppe“ die lustigste war, die sie jemals im Haus hatten.
Übrigens: Wieder in Berlin angekommen, lerne ich meinen jetzigen Freund kennen, dem ich überhaupt nur wegen meiner Glatze aufgefallen bin. Und einen neuen Job habe ich auch gleich gefunden.
Esther Parmodini Oppermann