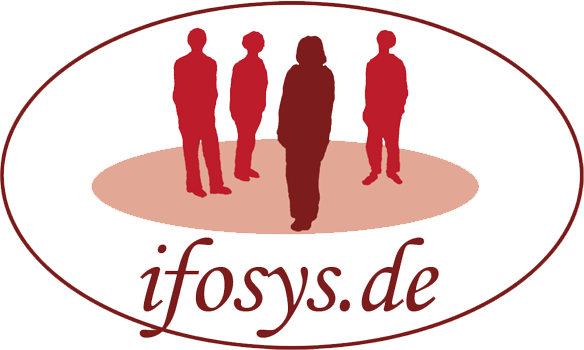Eine Katastrophe – wie eine 22-jährige sie erlebte
Geschrieben als Schulaufsatz zur Vorbereitung auf das externe Abitur von Maria Huesmann (späterer Ehename Maria Austermann) in Münster am 10. März 1946.
Den Artikel als PDF downloaden →
Als ich im Oktober 1944 aus dem schon fast ganz zertrümmerten Münster zum Lehrerstudium im herrlichen Dresden angelangt war, war es mir beinahe, als wenn ich in eine Wunderwelt versetzt worden wäre. Die Straßenbahnen glitten ruhig die Schienen entlang, als könne es gar nicht anders sein. Stolz standen der Zwinger, das Schloß, die Hofkirche, viele andere Kulturdenkmäler, Gebäude, ein jeder Häuserblock und jedes einzelne Wohnhaus da. Die Menschen atmeten freier. Es schien, als spürten sie nichts von dem furchtbaren täglichem Erleben ihrer Mitbrüder und Schwestern im Westen. Sie konnten noch fröhlich sein, diese Menschen, denen täglich die Sonne aus heiterem Himmel lachte.
Wenn man nach einem Dichterabend oder einem Hochamt – das oft die Musik eines Bach oder anderen großen Meisters, von einem guten Orchester aufgeführt – brachte, sich über die Brüstung der Elbbrücke lehnte und in den ruhig fließenden Strom schaute, der sich wie ein silbernes Band durch die Stadt schlängelte, überkam einen ein Gefühl des Glücks. Man spürte nichts von den drückenden Sorgen, die unser ganzes Volk belasteten. Da war man wie auf einer Friedensinsel. Die hochaufsteigenden Berge in der Ferne mit den in den schönsten Herbstfarben leuchtenden Wäldern schienen sie gegen alles Böse zu schützen.
Aber auch hier sollte das friedliche Leben einmal ein Ende finden. Seit den Anfangstagen des Februar lastete ein schwerer Druck auf der Stadt. Die Russen näherten sich der deutschen Grenze. Täglich trafen viele Flüchtlingszüge ein. Man rechnete damit, daß man sich mit diesen zusammen bald auf den Weg machen müßte. Die Stadt von sonst 700.000 Einwohnern schwoll in kurzer Zeit zu einer Zweimillionenstadt an. Alle Kinos, Theater, Schulen und jedes freie Plätzchen, das nur zu finden war, wurde den armen Menschen zur Verfügung gestellt. Zu Tausenden lagen sie da auf Stroh und harrten der Weiterverschickung. Da holte das Schicksal zum Schlage aus.
Als ich am Dienstag, den 13. Februar, abends um 10 Uhr noch zum Briefkasten ging, hörte ich aus vielen Häusern ein fröhliches Stimmengewirr und Musik. Es kam mir zum Bewußtsein, daß ja Karneval war. Am Tage hatte ich schon die Kinder in den buntesten Kostümen und ihren bemalten Gesichtern gesehen. Plötzlich wurde ich in meiner Träumerei aufgeschreckt durch das Heulen von Sirenen. Bald darauf stand ich vor meinen Büchern, um mir noch einige Kleinodien herauszusuchen. Im Wettlauf mit den Russen, die nur noch 100 Kilometer von der Stadt entfernt waren, konnte man ja nur wenig mitnehmen. Von meiner Geige und der Zither hatte ich mich schon losgerissen. Ich suchte mir die stärkste und wärmste Kleidung aus, um auf der Flucht genügend geschützt zu sein.
Plötzlich drang ein heller Schein durch die Ritzen der Verdunkelung in meiner Wohnung in der Steinstr. 14. Ein kalter Schrecken erfaßte mich. Ich lief auf den Flur und sah grausame Lichtstreifen durch die Fenster fallen. Sie rührten von den mir wohlbekannten „Christbäumen“ her. Ich eilte in den Keller, wo die Hausbewohner schon alle versammelt waren. Kaum war ich unten, als ich auch schon das Sausen der niederfallenden Bomben hörte. Die Menschen warfen sich hin! Kinder schrieen, Frauen jammerten! Leute, die Gott nicht mehr kannten, riefen ihn um Hilfe an. Der Boden schwankte. Die Bomben sausten, und Haus nach Haus hörte man einstürzen. Nach 20 Minuten war alles wieder ruhig. Bis auf herausgerißene Fenster- und Türrahmen war unser Haus unversehrt. die Nachbarhäuser brannten, die Hofkirche und Kunstakademie standen in hellen Flammen. Bei tatkräftigem Zugreifen ließ sich noch vieles retten. Ja, wenn dieses das Ende gewesen wäre, aber es war nur der Anfang!
Als wir die Kleidung, Wäsche und Betten aus den oberen Etagen getragen hatten, hörten wir wieder feindliches Motorengeräusch. Leuchtkugeln brauchten nicht mehr gesetzt zu werden. Der Brand erleuchtete die Stadt. Dieses Mal gingen wir alle mit naßen Handtüchern ausgerüstet in den Keller. Der Keller war noch nicht erreicht, als auch schon die Flugzeuge ihre ersten Lasten abwarfen. Der Boden schwankte nicht mehr, sondern er wackelte wie bei einem Erdbeben. Die Durchbrüche waren glücklicherweise beim ersten Angriff schon aufgebrochen worden. Menschen aus den schon eingestürzten und brennenden Nachbarhäusern kamen zu uns, indem sie sich halb kriechend und liegend vorwärtsbewegten.
Wegen der Überfülle verließ ich meinen Platz im Flur und rutschte langsam vorwärts in den Kartoffelkeller. Ich wußte mich kaum noch zu schützen gegen den furchtbaren Luftdruck, der sich bei jeder niederfallenden Bombe (jede Sekunde wenigstens eine) bemerkbar machte.
Plötzlich hörte ich kein Sausen mehr, nur noch den Krach des über mir zusammenstürzenden Gewölbes. Schwere Steinbrocken flogen mir auf den Kopf. Eine Leiter stürzte auf mich und schützte mich dadurch, daß sie den Druck der niederprasselnden Gesteinsmassen gleichmäßig auf mich verteilte. Das Handtuch glich inzwischen einem Aufnehmer, den man durch den Sand gezogen hatte. Glücklicherweise bekam ich einen Zipfel davon an den Mund, an dem ich saugen konnte, um ein wenig Luft im Halse zu bekommen. Ein furchtbares Gefühl war es, zu wissen, daß man verschüttet war. Ich rechnete mir schon aus, daß ich in meiner Lage keine 8 Tage mehr leben könnte. Ob man mich finden würde? Ich wollte doch noch nicht sterben! Jetzt, da ich ungefähr dem Tod ins Auge sehen konnte, packte mich ein unendliches Grauen. Ich betete, grübelte nach, ob ich nicht den lieben Gott durch ein Versprechen für mich günstig stimmen könnte, damit er mich aus dieser qualvollen Lage befreite. Ich fand nicht das Richtige. Dann schämte ich mich wieder für mich und meinen „Heldenmut“, daß ich ein Versprechen machen wollte, daß sich in Wirklichkeit schlecht ausführen ließ, nur damit der Körper weiterbestände. Ich wurde ruhiger und hoffte auf Gottes Hilfe. Ich sah meine Mutter vor mir, meinen Vater und meine Geschwister. Wer wollte den Eltern eine Stütze sein, wenn die älteste Tochter nicht mehr war? Viele liebe Menschen standen vor mir, die auch noch meiner Hilfe bedurften. Wer konnte das für mich tun? Mein Lebenszweck war doch noch nicht erfüllt!
Immer und immer noch neue Bombenwürfe! Die Schuttmassen schützten mich jetzt gegen den starken Luftdruck. Ein letzter Bombenruck kam, und ich fühlte, daß ein Fuß frei war. Lieber Gott, hilf mir weiter! Als ich eine geraume Zeit so lag, hörte ich ein fernes Rauschen. Ob ein Wasserrohr geplatzt war? Es rückte immer näher, und ich merkte zu meinem größten Schrecken, daß es kein Wasser war, sondern Feuer. Nun mußte ich meine ganze Kraft anwenden, um unter den Trümmern wegzukommen. Der freie Fuß zeigte mir den Weg. Ich schaffte es endlich, unter Aufwendung aller Kräfte mit Gottes Hilfe.
Ich kam in den Flur, der nicht eingestürzt war. Der Ausgang brannte lichterloh. Dahin mußte wohl eine Kanister gefallen sein. Im Feuerschein sah ich Menschen, die durch einen Durchbruch gingen. Durch ein weniger brennendes Zimmer eines Nachbarhauses ging es durch das Fenster auf die brennende Straße. Rechts brennende Häuser, links brennende Häuser, oben ein glühender Himmel und ein vom Feuer leuchtendes Pflaster, so sah es draußen aus. In der Hölle konnte es nicht schlimmer sein. Jetzt hieß es laufen, damit man nicht verbrannte. Es waren nur 100 Meter bis zur rettenden Elbe. Endlich war sie erreicht. Gefangenen Russen warf ich mein Handtuch zu, damit sie es ausspülten. Ich sog das Wasser aus dem dreckigen Handtuch, um endlich wieder atmen zu können, ich wusch mein Gesicht und die Hände damit, aber fast ohne Erfolg. Der Dreck war wie eingebrannt.
Allmählich wagte ich, um mich zu blicken. Nur Feuer, nichts als Feuer! Ein Wirbelsturm sauste, der keinen Menschen stehen ließ. Die Elbe gebärdete sich so wild, als müßte sie die Leichen, die am Ufer lagen, fortspülen. Die Leichen! Die Verwundeten! Es war ein entsetzlicher Anblick! Wie konnte man nur helfen? Ich wollte versuchen zum Pfarrhaus der Hofkirche durchzukommen, aber nicht nur der Sturm, sondern auch ein SS-Mann hielt mich zurück. Ich sah, daß das Pfarrhaus brannte. Warum wollte ich von dort Hilfe holen? Das Nachdenken war mir unmöglich. Ich wollte weg, weg von dem Ort des Todes und der Qualen. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich der langen Kolonne der Menschen anzuschließen und die Elbe entlang zu wandern. Unendliche Furcht und Not war auf allen Gesichtern zu lesen.
Ein etwa 18jähriger Jüngling brach zusammen und rief: „Nehmt mich bitte mit!“ Es klang wie ein letztes Todesröcheln. Die Menge zog gefühllos weiter. Jeder hatte mit sich selbst so viel zu schaffen. Der Jüngling blieb liegen, um wohl einige Minuten später seinen Geist aufzugeben. Es war ein mühsames Gehen auf den durch Bomben aufgewühltem Wege. 6 km ging es immer die brennende Stadt entlang.
Dann sah ich das erste Haus, das nicht brannte. Der unaufhörliche Menschenzug bewegte sich über die nur leicht beschädigte Loschwitzer Elbbrücke. Greise, Greisinnen, Männer, Frauen und Kinder schleppten sich vorwärts. Man sah sogar Leute in Fastnachtskostümen mit noch geschminkten Gesichtern, auf denen die Farbe jetzt verwischt war. (Sie wirkten dadurch als wollten sie nur dem Schicksal trotzen.) Sie mochten vielleicht daran denken, wie traurig ihr lustig begonnener Abend endete. Alle, die hier zogen, gehörten ja noch zu dem glücklicheren Teil den Menschen Dresdens, denn sie waren ja nicht verschüttet, mußten nicht verbrennen, wie es das Schicksal vieler Tausende war. (200.000 Tote wurden von der Partei einige Zeit später zugegeben.) Die Menschen schleppten sich weiter. Fast alle ohne ein bestimmtes Ziel, auf die Hilfe fremder Menschen hoffend. Einem unsicheren Schicksal gingen sie entgegen.
Maria Huesmann